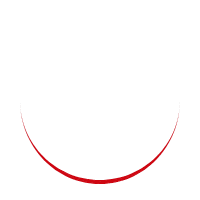Sarah, 31 Jahre, hat gelernt, mit der Diagnose Juvenile Dermatomyositis zu leben. Obwohl ihr die Krankheit viele Steine in den Weg legt, ist für sie Aufgeben keine Option. Für die Kampagne «Ich und mein Rheuma» erzählt sie, wie sie ihren Alltag meistert.
Der Beginn einer langen Reise
Die Reise, die im Januar 2002 begann, wählte ich nicht selbst. Aus heiterem Himmel, ich war damals 13 Jahre alt, schmerzten plötzlich meine Hände, Beine und Knie. Hände und Knie waren geschwollen und rot gefärbt. Die anfangs nur leichten Symptome wurden innerhalb eines Monats immer stärker, so dass ich die Beine kaum mehr bewegen konnte. Sie waren zu zwei dicken Pfosten angeschwollen. Ich konnte meine Hände nicht mehr richtig gebrauchen und meine Arme nicht einmal mehr bis auf Schulterhöhe anheben. Das Haarewaschen und -bürsten wurde schwierig. Um meine Augen bildeten sich braune Kreise (ähnlich wie «Waschbären- oder Panda-Augen»). Die Haut wurde sehr empfindlich und war schnell gereizt. Berührungen waren schwer zu ertragen. Meine Beine wurden schwer wie Blei: Ich hatte kaum mehr die Kraft, einen Fuss vor den anderen zu setzen. Der Weg vom Bett zum WC oder in die Küche fühlte sich an, wie ein Marathon. Die Schultern drückten mich zu Boden, ich konnte mich nicht mehr aufrichten. Hinzu kamen noch eine unsägliche Müdigkeit und Erschöpfung: Ich konnte schlafen so viel ich wollte, doch die Entzündung strengte meinen Körper sehr an. Diese Verstärkung der Symptome erfolgte, als ich mit meiner Familie in den Sportferien weilte. Nach der Rückkehr suchten wir den Kinderarzt auf, der mich umgehend ans Kinderspital überwies. Dort waren sich die Ärzte wegen der Diagnose unsicher. Sie vermuteten zuerst Juvenile Polyarthritis, doch passten verschiedene Komponenten des Krankheitsbildes nicht hundertprozentig.
Juvenile Dermatomyositis: selten und wenig erforscht
Bei der dritten Konsultation wurde mir die Diagnose eröffnet: Juvenile Dermatomyositis – sprich eine Autoimmunkrankheit, bei der sich Haut und Muskeln entzünden. Warum die Krankheit auftauchte und woher sie kam? Niemand wusste eine genaue Antwort auf diese und viele andere Fragen, die sich mir und meiner Familie stellten, da es sich um eine sehr seltene und noch kaum erforschte Krankheit handelt. Ich brauchte etwa 6 Monate, bis ich mir allein den Namen dieser unbekannten Krankheit merken konnte. Zu verstehen, worum es bei dieser Krankheit wirklich geht und, was dies bedeutet, dauerte noch länger. Es vergingen Jahre, bis ich «verstand» und ich mich mit dieser Situation arrangieren konnte.
Lange Suche nach dem passenden Medikament
Durch unzählige Untersuchungen versuchten die Ärzte den genauen Zustand meines Körpers kennenzulernen und mögliche weitere Krankheiten auszuschliessen. Auf gängige Medikamente und Schmerzmittel reagierte mein Körper nicht, so dass als mögliche Therapien nur noch Immunglobulin oder Cortison in Frage kamen. Da bei den Immunglobulinen weniger und schwächere Nebenwirkungen als beim Cortison zu erwarten waren, startete ich zuerst mit diesen. Die Immunglobuline erhielt ich in Form einer Infusion. Eine solche dauerte jeweils ungefähr fünf Stunden. Die ersten beiden Infusionen schienen eine positive Wirkung zu haben, doch die aufkeimende Hoffnung wurde schnell zunichte gemacht. Mein Körper sprach nicht mehr darauf an. In der Schule fehlte ich oft, da ich zu Kontrollen oder Infusionen ins Kinderspital musste. Mitschüler verstanden nicht, was mit mir los war und hatten Angst, sich bei mir anzustecken.
Cortison: Fluch und Segen zugleich
Da die Immunglobuline nicht halfen, blieb nur das Cortison. Und zwar in Kombination mit Methotrexat und anderen Medikamenten. Das war der Beginn einer langen Odyssee auf der Suche nach einem Medikament, das die Entzündung bei dieser Krankheit hemmt und eventuell sogar stoppt. Mit der hohen Dosis von 100mg Cortison startete ich die Therapie und nahm wie erwähnt noch weitere Medikamente ein. In kurzer Zeit nahm ich zehn Kilogramm Körpergewicht zu. In der Schule redeten die Mitschüler bald vom Vollmondgesicht - und meinten mich damit. Es war eine sehr schwierige Zeit. Die Schule lag glücklicherweise nahe bei meinem Elternhaus, so dass ich mich über Mittag hinlegen konnte, um den Tag besser durchzustehen. Das Cortison schien seine Wirkung zu entfalten und ich konnte die Dosis nach und nach in einem sehr langsamen Tempo reduzieren. Es schien alles gut eingestellt zu sein und ich absolvierte eine Lehre als Kauffrau im Reisebüro mit Berufsmaturität. Auch während dieser Zeit gab es immer wieder Situationen, in denen die Krankheit sich von ihrer ungemütlichen Seite zeigte.
Arthritis als eine der Folgen der Myositis
Gegen Ende der Ausbildung schien sich die Krankheit etwas beruhigt zu haben, so dass ich sogar für einen Sprachaufenthalt vier Monate nach Neuseeland reisen durfte. Während meiner Zeit in Neuseeland konnte ich das Cortison absetzen, doch die nächste Schwierigkeit liess nicht lange auf sich warten. Nach dem Absetzen des Cortisons entwickelte sich als eine von verschiedenen Folgen der Myositis eine Arthritis, die sich jeweils besonders im Herbst auswirkte und immer noch auswirkt. Ich musste viele Jahre das Methotrexat auf eine maximale Dosis hochschrauben und ein zusätzliches Medikament einnehmen. Die Wirkung war nicht so stark wie erhofft, so dass ich auch während mehrerer Monate jeweils im Herbst/Winter erneut zu Cortison greifen musste. Die Situation verschlimmerte sich immer mehr und die Dosis an Cortison wurde immer höher angesetzt. Die Krankheit zeigt sich nicht immer im selben Ausmass und mit denselben Symptomen, was das Erfassen der Krankheit nicht einfacher machte. Mit der Zeit entwickelten sich Krämpfe, welche schmerzten und einschränkten. Diese tauchten in verschiedenen Körperregionen vor: in den Armen, Händen und Beinen. Die Krämpfe in den Waden verunmöglichten mir das Laufen.
Ratlosigkeit auch auf Ärzteseite
Etwas war damals besonders schlimm für mich: Die behandelnde Ärztin hatte mit Myositiden keine oder wenig Erfahrung und anerkannte meine Krankheitsaktivitäten teilweise nicht, sondern tat sie als «psychisch» ab. Ich wurde tief traurig, aber auch wütend. Schon früher im Kinderspital stellten die Ärzte fest, dass meine Blutwerte durch die Medikation so verändert wurden, dass die Krankheitsaktivität im Blutbild sehr oft nicht ersichtlich war. Mit einem bildgebenden Verfahren wie MRI konnte die Entzündung aber nachgewiesen werden. Durch einen von mir angestrebten Arztwechsel fand ich endlich zu einer Person, die mich ernst nahm und mir Glauben schenkte, d.h. meine gesundheitlichen Schwächen und die Krankheitsaktivität sah. Das war für mich eine unheimliche Erleichterung.
Studienabschluss trotz Einschränkungen
In der Zwischenzeit wollte ich mich beruflich neu orientieren und studierte Soziale Arbeit. Meine Krankheit wirkte sich auch auf mein Studium aus, besonders als diese häufiger und länger aktiv wurde und ich in der Folge zu wenig Energie und Zeit hatte, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich brauchte mehr Zeit, um mich auszuruhen und meine Kräfte zu sammeln. Die eingestellte Medikation schien nicht mehr genügend zu wirken. Es folgten mehrere Jahre, während denen ich verschiedene Medikamente austesten und sehr viel Cortison nehmen musste, manchmal gespritzt, manchmal in Tablettenform oder als Infusion. Sobald ich das Cortison reduzierte, flackerte die Entzündung wieder auf. Kein anderes Medikament schien für mich geeignet zu sein. Trotz all der Einschränkungen konnte ich mit dem Abschluss des Studiums einen grossen persönlichen Erfolg feiern.
Freundschaften und Beziehungen auf dem Prüfstand
Auch Freundschaften gingen wegen der Krankheit in die Brüche und das Führen einer Beziehung gestaltete sich schwierig. Mit siebenundzwanzig lernte ich meinen jetzigen Partner kennen. Aufgrund meiner Erfahrungen wollte ich von Anfang an Klarheit schaffen und erzählte ihm von meiner Krankheit, aber das schreckte ihn nicht ab. Beim nächsten Krankheitsschub hatte ich Angst, er würde wegrennen, wie schon Andere. Aber: Der Schub kam und klang ab - und mein Partner war immer noch an meiner Seite. Weitere Schübe folgten und mein Partner blieb bei mir. Er behielt (und behält) seine positive Einstellung und meint jeweils: «Es kommt schon wieder besser.» Leider entwickelte sich meine gesundheitliche Situation in den letzten 5 Jahren eher in die entgegengesetzte Richtung.
Verarbeitung und weiterer Verlauf
Ich war also schon eine ganze Weile mit meinem Handicap unterwegs und hätte das eine oder andere Mal aufgeben wollen. Durch die langanhaltende Medikation mit Cortison schlitterte ich zwei Mal in eine Depression. Das erste Mal gleich zu Beginn nach der Gabe der ersten hohen Dosis. Das zweite Mal geschah es in der Zeit, in der ich mein Studium abschloss. Ich hatte glücklicherweise helfende und zuversichtliche Menschen an meiner Seite, und ich selbst versuchte auch immer alles zu tun, um wieder aufzustehen und zumindest psychisch zu genesen.
Immer wenn ich dachte, schlimmer kann es nicht mehr werden, sagte ich mir: «Es muss einfach weiter gehen und wieder besser werden.» Ich lernte herauszufinden, was mir guttat und mich stärkte. Besonders wichtig war und ist für mich, dass ich mich selbst nicht auf die Krankheit reduziere und dass auch andere das nicht tun. Dies wird vor allem dann schwierig, wenn die Krankheit verstärkt aktiv ist und ich zu kaum etwas imstande bin.
Vollgepumpt mit Cortison
Die Ärzte waren immer wieder ratlos und wussten nicht weiter. Auf keines der Medikamente schien ich anzusprechen und musste deshalb immer öfter immer höhere Dosen Cortison einnehmen. Einige Male wurden mir hohe Cortisonstösse (intravenös) stationär im Spital verabreicht. Mein Körper war richtig vollgepumpt davon. Die meisten Menschen reagieren euphorisch auf solche Mengen Cortison, sind aufgeputscht und voller Energie – bei mir aber sank die Stimmung in den Keller. Diese und weitere unzählige Nebenwirkungen zeigten sich unter Einnahme von Cortison; unter anderem mehrfache Gewichtszu- und abnahmen.
Arbeitsplatzverlust und Sozialversicherungskrieg
Durch die ständige Krankheitsaktivität fehlte ich immer wieder bei der Arbeit, und schliesslich verlor ich eine Arbeitsstelle deswegen. Als Grund wurde mir die fehlende Kontinuität genannt, welche ja auf die Krankheit und dessen ungenügende Medikation zurückzuführen ist. Zur gleichen Zeit war ich mitten in einem Verfahren mit den Sozialversicherungen und litt erneut an verstärkter Krankheitsaktivität, kurz: Meine Energiereserven und meine positive Haltung wurden ziemlich stark ausgereizt.
Hoffnung auf Besserung durch neues Medikament
Ende August 2019 eröffnete sich die Möglichkeit, es mit einem neuen Medikament zu versuchen, das zwar nicht auf mein Krankheitsbild zugelassen, von den Voraussetzungen aber ziemlich passend war. Aktuell deutet alles darauf hin, als ob dieses Medikament wirke. Ich konnte eine grosse Menge Cortison reduzieren und bin bei einer tiefen Dosis wie seit langem nicht mehr. Ich mag mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Sehr starke Krankheitsschübe sind seither ausgeblieben, selbst wenn die Krankheitsaktivität wieder ausbricht, erhole ich mich schneller als zuvor. Der nächste Schritt ist, die niedrigstmögliche Dosis Cortison und weitere Optimierungen in der Medikation zu finden.
Tun, was mich erfüllt
Mir liegt viel daran meine Träume und Ziele zu verwirklichen, auch wenn diese auf meine Situation angepasst werden müssen. Zu oft bekam ich zu Ohren, was kranke vor allem chronisch kranke Menschen eben nicht können. Doch ich lasse mich nicht davon abhalten, das zu tun was mir guttut und mich erfüllt. Das Verfahren mit den Sozialversicherungen ist inzwischen teilweise abgeschlossen und zu meinen Gunsten entschieden. Seit Herbst 2019 habe ich auch eine neue Stelle als Sozialarbeiterin, bei der es richtig gut läuft und ich keine Angst haben muss, dass ich meine Stelle schon wieder bald verliere.
Aufgeben ist keine Option

Die Krankheit hinterlässt Spuren und schränkt ein, selbst wenn sie nicht aktiv ist. Sie ist immer präsent und bestimmt ein Stück weit den Alltag. Aber was einen normalen Alltag verunmöglicht, sind starke Krankheitsschübe. Wenn diese von nun an ausbleiben, ist alles andere irgendwie machbar. Durch meine Krankheit lernte ich mich besser kennen und es haben sich mir ganz viele neue Themen und Interessensgebiete aufgetan. Meditation begleitet mich seit vielen Jahren bis heute regelmässig und ich habe wieder meine Leidenschaft fürs Malen und Yoga entdeckt. Auch lernte ich die kleinen Dinge zu schätzen und dankbar zu sein für alles, was geht, auch wenn fast nichts mehr geht. Zudem lehrte mich meine Krankheit, dass es immer einen Weg gibt. Es geht immer weiter und wir Menschen können lernen, mit vielem umzugehen. All meine Erfahrungen durch die Erkrankung bezeichne ich oft ironischerweise als eine private-berufliche Weiterbildung – diese Erfahrungen helfen mir in meiner Arbeit als Sozialarbeiterin. Aufgeben war nie eine Option für mich, ich habe einen unbändigen Lebenswillen und kämpfe für mich.