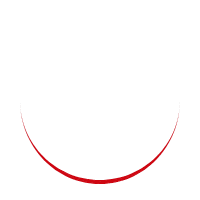Damals, 2007
Schon früh hatte sich Monika Schütze ihren Lebensplan zurecht gelegt. Sie wünschte sich einen spannenden Teilzeitjob mit viel Zeit für schöne Reisen. Dass dieser Traum platzte, liegt jedoch nicht an mangelndem Einsatz, sondern an ihrer Erkrankung. Heute weiss die 41-Jährige, dass im Leben nicht alles planbar ist. Doch auch wenn sie ihr Schicksal akzeptiert hat, einfach ist der Alltag mit einer Krankheit ohne Zukunftsprognose nicht.

Wie immer wenn Monika Schütze im Ausland war, genoss sie auch vor 18 Jahren ihren Aufenthalt in den USA und in Mexiko. Allerdings war diese Auszeit nicht ganz so unbeschwert wie sonst. Immer wieder kämpfte sie mit Gelenkproblemen und Durchfall. Ob die Schmerzen vom unbequemen Bett und der Durchfall von der ungewohnten Ernährung herrührten? Sie wusste es nicht. Erst als ihre Leiden auch zu Hause nicht verschwanden, entschloss sie sich zu einem Arztbesuch und erhielt die Diagnose «Hepatitis B».
«Wann und wo sollte ich mich angesteckt haben?», ging es Monika Schütze durch den Kopf. Dieser Befund war für sie nicht nachvollziehbar. Nicht nur ihr Verstand, auch der Rest des Körpers schien mit der Diagnose nicht einverstanden zu sein. Noch immer hatte sie grosse Schmerzen. Nach einem weiteren Arztbesuch wurde sie an einen Rheumatologen verwiesen, der ihr eine neue Diagnose mitteilte: Monika Schütze hatte eine Krankheit mit dem Namen «mixed connective tissue disease». Dabei handelt es sich um eine schwerwiegende rheumatische Erkrankung, die dem «Systemischen Lupus erythematosus» sehr ähnlich ist. Dies ist eine entzündliche Erkrankung, bei der das Immunsystem die eigenen Organe angreift, krankhafte Verdichtungen der Haut auftreten und sich Muskeln entzünden. «Was dies alles für mein Leben bedeuten sollte, wusste ich damals natürlich noch nicht. Aber ich war erleichtert, dass meine Krankheit nun einen Namen hatte», erinnert sich Monika Schütze.
Wechselspiel zwischen Freud und Leid

Nach der Diagnose startete Monika Schütze eine Cortison-Behandlung – kurz darauf fühlte sie sich wie neugeboren. Doch das gute Gefühl hielt nicht lange an und in den darauffolgenden Jahren fühlte sich die junge Frau wie ein schaukelndes Schiffchen auf dem offenen Meer. Sie kämpfte gegen Bewegungsstörungen, Fieberschübe und Gelenkschmerzen. Es folgten Untersuchungen, längere und kürzere Spitalaufenthalte, Computertomografien, MRI und Infusionsbehandlungen.
«Das Schlimmste für mich ist die Unberechenbarkeit, die meine Erkrankung mit sich bringt», sagt Monika Schütze nachdenklich. Früher habe sie sich ganz auf ihren Körper verlassen können – heute wisse sie noch nicht mal, ob sie den Weg zur Tramstation gut hinter sich bringen könne. Mit dieser Unsicherheit zu leben, fällt ihr schwer. «Eine wichtige Anlaufstelle war und ist die Selbsthilfegruppe für Lupus-Betroffene», sagt Monika Schütze. In dieser Gruppe habe sie nicht nur gelernt, über ihre Ängste zu sprechen, sie habe auch ihr Wissen über die Krankheit vertiefen können. Und das sei für sie enorm wichtig. «Je besser ich über meine Krankheit informiert bin, desto besser kann ich mit ihr leben. Denn die Unwissenheit in Bezug auf meine Krankheit macht mir mehr Angst als die teilweise erschreckenden Aussagen, die ich darüber lese.»
Trost und Ablenkung in schwierigen Zeiten

Eine hilfreiche Methode mit schwierigen Momenten umzugehen, ist die Arbeit. Dass Monika Schütze überhaupt noch berufstätig sein kann, empfindet sie als Geschenk. Denn nach ihrer Arbeit als Verkäuferin hatte sie zwar eine Stelle im Büro, doch leider ging ihr Arbeitgeber Konkurs. «Mir war klar, dass ich mit meiner Krankheit keinen Job mehr kriegen würde», sagt sie. Also wandte sie sich an die Rheumaliga und füllte mit deren Hilfe einen Antrag auf Invalidenrente aus. Heute lebt sie von der IV-Rente und ist jedoch froh, mit einem kleinen Pensum im Verkaufsladen der sozialen Stellenbörse Basel arbeiten zu können. Im Laden, in dem selbst hergestellte Produkte von Behinderten verkauft werden, begleitet Monika Schütze Menschen in einer IV-Abklärung. Während vier Nachmittagen pro Woche teilt sie ihnen Arbeiten zu, kontrolliert diese und gibt Feedback. Die enge Zusammenarbeit mit Menschen, die ebenfalls in ihrem Beruf eingeschränkt sind, tut ihr gut. «Sicher ist es ein Vorteil, dass ich selbst krank bin. So habe ich mehr Verständnis für Menschen mit einer Behinderung.»
Mit den Kräften haushalten
Nicht nur im Berufsleben fühlt sich Monika Schütze mit behinderten Menschen manchmal aufgehobener als mit nicht Behinderten. «Menschen ohne körperliche Einschränkungen können nur schwer verstehen, wenn ich müde und erschöpft bin. Viele meinen, sie müssen mich dann motivieren und anspornen – dabei würde es mir besser gehen, wenn ich mich einfach hinsetzen könnte.» Dass behinderte Menschen ein anderes Verständnis für körperliche Grenzen haben, liegt auf der Hand. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, weshalb sich Monika Schütze heute bei der Wassergymnastik des Behindertensports wohler fühlt als im Turnverein. «Hier sind viele Menschen körperlich eingeschränkt – ich falle nicht auf und bin auch nicht im Mittelpunkt.»

Wassergymnastik ist jedoch nicht nur ein Hobby, sondern auch eine von vielen Therapieformen im Leben von Monika Schütze. Feldenkrais, Physiotherapie und Krafttraining sind weitere Aktivitäten, die ihr helfen, ihren Körper beweglich zu halten. Und genau das ist ihr ein grosses Anliegen. Denn auch wenn sie gegen körperliche Blockaden nichts unternehmen könne – wenn sie beweglicher sei, könne sie diese besser überwinden. So gesehen ist Beweglichkeit ein Stück Unabhängigkeit. Eine Unabhängigkeit, die jedoch mit viel Aufwand erarbeitet sein will. Pro Woche wendet die junge Frau zwischen fünf und sechs Stunden für Körpertherapien und Arztbesuche auf. «Diese Termine verteilen sich zwar auf vier bis fünf Vormittage – für mich ist das aber ziemlich anstrengend», sagt Monika Schütze. Und wenn es dann Menschen gebe, die glauben, sie würde am Morgen ausschlafen, erzähle sie jeweils ausführlich von ihrem vollen Wochenprogramm. «Denn wie mein Alltag mit der Krankheit aussieht, können sich viele Menschen nicht vorstellen.»
Heute, 2025
«Ich habe das Gefühl, ein wenig schneller zu altern als gesunde Menschen.»

Bereits 17 Jahre ist das ursprüngliche Interview mit Monika Schütze her. Von einer Krankheit ohne Zukunftsprognose war damals die Rede. Umso spannender, dass forumR von der heute 58-Jährigen ein Update erhalten hat:
Wie bei vielen Menschen mit einer chronischen Krankheit hat sich auch die Krankheitsgeschichte von Monika Schütze weiterentwickelt. Ursprünglich mit einem Systemischen Lupus diagnostiziert, kam in den letzten Jahren ein Parkinson-Syndrom hinzu. Trotz diverser Rehas, verschiedener Therapien und Medikamente konnte sich Monika Schütze zusehends schlechter bewegen: Sie kippte beim Gehen immer stärker auf die Seite und die Aufrichtung zu ihrer vollen Grösse war nicht mehr möglich. Auch wenn sie den Lupus behielt, trat dieser neben dem Parkinson in den Hintergrund, wie Monika Schütze erklärt. Denn durch den Lupus ausgelöste Schübe hat sie mittlerweile fast keine mehr.
2013 wurde ihr eine tiefe Hirnstimulation (THS) als Behandlung des Parkinsons empfohlen. Ein Jahr später liess sich die Baslerin operieren und profitierte nach einigen Anlaufschwierigkeiten vom Eingriff: Die Bewegungsabläufe wurden wieder geschmeidiger und kontrollierter. Vor kurzem wurde die THS grundlegend neu eingestellt. Das Ganze sei noch ein wenig holprig; die linke Körperseite mit der linken Hand bereite noch Probleme. Zudem vermischen sich die Schnappfinger der Lupus-Erkrankung mit der Steifheit und den Überbewegungen (Dyskinesie) des Parkinson-Syndroms.
Eine Zukunftsprognose ist mit zwei Krankheiten sicherlich noch schwieriger geworden. Doch davon lässt sich Monika Schütze nicht beirren: Die Frührentnerin ist nach wie vor eine passionierte Bastlerin, teilt sich ihre Aktivitäten heute jedoch besser ein. Sie macht Pausen, wenn sie erschöpft ist, und holt sich Hilfe, wo notwendig. Monika Schütze hat ihre Situation angenommen – auch die Tatsache, dass sie wohl einfach etwas schneller altert als andere Menschen.
Wird umgangssprachlich auch als «Hirnschrittmacher» bezeichnet. Bei einer Operation werden Elektroden ins Gehirn eingesetzt, die dauerhafte elektrische Impulse abgeben und so die Symptome – bspw. einer Parkinsonerkrankung – beeinflussen können.
Text erschienen im forumR 1/2025
Autorinnen: Astrid Steiner und Daria Rimann
Fotos: Susanne Seiler