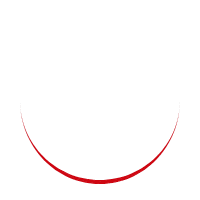Was sind Schmerzmittel, welche Unterschiede sollte man kennen und wie wendet man Schmerzmedikamente bei Rheuma richtig an? Dieser Artikel gibt einen Überblick und Tipps.
Rheumatische Erkrankungen sind fast immer mit Schmerzen verbunden. Umso näher liegt der Griff zu Schmerzmitteln. Aber welche Schmerzmedikamente sind bei welchen Rheumaschmerzen sinnvoll und nützlich?
Wie wirken Schmerzmittel?
Schmerzmittel (Analgetika) verändern, reduzieren oder beseitigen Signale, die zu Schmerz führen können. Sie unterdrücken somit das Symptom, ohne die Ursache des Schmerzes zu bekämpfen.
Schmerzmittel bei Rheuma?
>> Bei entzündlich-rheumatischen Krankheiten werden reine Schmerzmittel (ohne entzündungshemmende Wirkung) nur zusätzlich zu den entzündungshemmenden Medikamenten verschrieben. Sie ergänzen dann die medikamentöse Entzündungshemmung.
>> Am ehesten kommen reine Schmerzmittel bei einer schmerzhaften Arthrose zur Anwendung. Oder allgemeiner: Wenn die Entzündungskomponente nur eine Nebenrolle spielt oder sich gar keine Anzeichen einer Entzündung zeigen. Lesen Sie mehr dazu am Ende dieses Beitrages.
Was gibt es für Schmerzmittel?
Fundamental wichtig ist der Unterschied von opioiden und nicht-opioiden Schmerzmitteln. Zusätzlich zu diesen zwei Klassen kann man die Schmerzmittel gemäss dem Stufenschema der WHO in drei Gruppen einteilen. Beide Gliederungen sind nur grob, aber helfen, sich im Universum der Schmerzmedikamente zu orientieren.
Opioide
«Opioid» bedeutet opiumähnlich. Opium (von griechisch opos = Saft) ist der getrocknete Saft der unreifen Samenkapseln des Schlafmohns. Daraus wird bis heute Morphin gewonnen, früher Morphium genannt, ein bei starken und stärksten Schmerzen zugelassenes pflanzliches Schmerzmittel. Es stand Pate bei der Entwicklung verschiedener Substanzen mit morphinähnlicher Wirkung, die heute die Grosszahl der Opioide ausmachen.
Gemeinsam ist allen Opioiden, dass sie an Opioidrezeptoren andocken. Diese finden sich auf der Oberfläche von Nervenzellen und weiteren Zellen im ganzen Körper. Die meisten Opioidrezeptoren sitzen im Gehirn und im Rückenmark, viele auch im Darm. Wenn Opioide andocken, aktivieren sie das körpereigene System zur Schmerzmodulation. Es hemmt im Rückenmark die Weiterleitung von Gefahrensignalen und unterdrückt im Gehirn die Schmerzwahrnehmung.
Zur Schmerzlinderung gesellen sich weitere morphinartige Wirkungen, wie die sedierende und die euphorisierende Wirkung. Das heisst, Opioide beruhigen und verursachen ein überschwängliches Glücksempfinden (Euphorie).
Alles Substanzen, die über die Opioidrezeptoren wirken, sind nach heutigem Sprachgebrauch Opioide. Also nicht nur die chemisch-synthetischen Opioide, sondern auch rein pflanzliche, aus Opium gewonnenen Opioide, ebenso wie das körpereigene Opioid Endorphin, eine Wortschöpfung aus «End» (von «endogen», innerlich erzeugt) und «Morphin» ohne das anfängliche M. Eine starke Endorphin-Ausschüttung in Notfallsituationen kann bewirken, dass Personen mit schweren Verletzungen in den ersten Augenblicken keinen Schmerz empfinden. Ebenfalls morphinähnlich ist die euphorisierende Wirkung von Endorphinen. Es gibt also dreierlei Opioide:
Endogenes Opioid: Endorphin
Pflanzliche Opioide: Morphin, Codein
Synthetische Opioide: Tramadol, Tilidin, Fentanyl, Oxycodon, Buprenorphin, Pethidin, Hydromorphon usw.
Die pflanzlichen Opioide heissen auch Opiate. Übrigens hat das Opiat Codein eine stark hustenstillende Wirkung und ist daher im manchen Hustensäften enthalten.
Nicht-opioide Schmerzmittel
Schmerzmittel, die nicht an Opioidrezeptoren binden, sondern andere Wege einschlagen, heissen nicht-opioid. Einige wirken vermutlich an Rezeptoren im Gehirn, während andere die Bildung von Prostaglandin reduzieren. Prostaglandine sind körpereigene Botenstoffe, die im Rahmen von Entzündungsprozessen die Weiterleitung von Reizen verstärken.
Metamizol
Das wohl stärkste nicht-opioide Schmerzmittel ist Metamizol, auch bekannt als Novaminsulfon. Dieses rezeptpflichtige Medikament wirkt sehr effektiv, ist aber umstritten, weil es als seltene Nebenwirkung eine gravierende Blutbildveränderung (Agranulozytose) verursachen kann.
Paracetamol
Sehr verbreitet sind Paracetamolpräparate wie Dafalgan®, Panadol®, Tylenol® oder Zolben®. Sie sind nebenwirkungsarm und grösstenteils frei verkäuflich, aber nicht unbedenklich. Paracetamol kann nämlich bei einer Überdosierung in kurzer Zeit die Leber schädigen. Wenn Sie gleichzeitig ein paracetamolhaltiges Erkältungsmittel wie NeoCitran® oder Pretuval® einnehmen, kann die maximale Tagesdosis von 4 Gramm schnell überschritten sein. Am besten kombinieren Sie vorsichtshalber gar nie ein Grippe- und ein Schmerzmittel.
Capsaicin, Cannabinoide und andere Pflanzenstoffe
Ebenfalls zu den nicht-opioiden Schmerzmitteln zählen pflanzliche Stoffe wie das Capsaicin aus Chili, die neurotoxischen sekundären Pflanzenstoffe des giftigen Blauen Eisenhutes oder die Cannabinoide des Hanfes, wie insbesondere das schmerzdistanzierende und muskelentspannende THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol). Cannabinoide wirken, indem sie an spezifische Cannabinoid-Rezeptoren des körpereigenen Endocannabinoid-Systems andocken (was vermutlich auch Metamizol kann).
NSAR
Diclofenac, Ibuprofen und die Acetylsalicylsäure (Aspirin®) zählen ebenfalls zu den Schmerzmitteln, sind aber keine reinen Schmerzmedikamente. Die schmerzlindernde Wirkung ist bei ihnen eng mit einer fiebersenkenden und entzündungshemmenden Wirkung verbunden. Sie bilden daher als nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) eine eigene Gruppe.
Was sagt das WHO-Stufenschema?
1986 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation ein Schema zur medikamentösen Schmerzbehandlung bei Krebserkrankungen. Dieses Stufenschema wird inzwischen auch ausserhalb der Onkologie verwendet und ist für die allgemeinere Verwendung erweitert worden.
Gemäss dem Stufenschema soll jede Schmerztherapie mit nicht-opioiden Substanzen anfangen. Wenn diese ungenügend wirken, kommen schwache Opioide zum Zuge (Stufe 2). Bei unzureichender Wirkung können minimalinvasive Verfahren hinzugezogen werden, die in einer letzten Stufe um starke Opioide ergänzt werden. Dabei lassen sich opioide Schmerzmittel, nicht-opioide Schmerzmittel und adjuvante Schmerzmittel (das sind Mittel, die Schmerzen beeinflussen können, aber nicht dafür entwickelt wurden) miteinander kombinieren.

Welche Schmerzmittel machen abhängig?
Grundsätzlich können alle Opioide abhängig machen, weil sie in die Hirnchemie eingreifen und bei regelmässiger Einnahme rasch zu einer Gewöhnung führen. Der Körper verlangt dann immer öfter bis durchgehend Nachschub. Man spricht dabei von einer Toleranzentwicklung: Um dieselbe Wirkung zu erzielen, ist eine immer höhere Dosis nötig.
Die Abhängigkeit wird durch die euphorisierende Wirkung von Opioiden begünstigt, indem das Belohnungssystem aktiviert wird. Zudem hat die Art der Einnahme einen Einfluss auf das Abhängigkeitsrisiko: Je schneller Substanzmengen in den Blutkreislauf gelangen, desto rascher wird das Gehirn damit geflutet – und desto grösser ist das Risiko, abhängig zu werden.
So erleben Konsumierende einen sogenannten Flash, wenn sie die Substanz inhalieren oder intravenös zugeführt bekommen. Als Tablette eingenommen, dauert es länger, bis die Substanz wirkt. Zum einen, weil Tabletten von einer Schicht umgeben sind, die den Inhalt nach und nach freigibt, zum andern, weil die Substanz durch die Darmbarriere langsamer ins Blut gelangt.
Opioide sollten deswegen nur ausnahmsweise über längere Zeit hinweg angewendet werden. Auch nicht zu unterschätzen sind ihre Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung. Kein oder kaum ein Abhängigkeitsrisiko und weniger Nebenwirkungen haben die nicht-opioiden Schmerzmittel, mit Ausnahme von stark THC-haltigem Cannabis.
Wann welche Schmerzmittel einsetzen?
Wenn Sie an einer Arthrose leiden, haben Sie es sich vielleicht angewöhnt, vor einer geplanten Wanderung oder dem wöchentlichen Gymnastikkurs ein Paracetamol «einzuwerfen», um sich schmerzfrei bewegen zu können. Grundsätzlich befürwortet die Rheumaliga die präventive Einnahme eines nicht-opioiden Schmerzmittels zu diesem Zweck. Die gezielte Anwendung kann Sie einsatzfähig machen und Sie von den positiven Wirkungen der Bewegung profitieren lassen. Zu beachten ist aber auch in diesem Falle, dass Schmerzmittel die von Arthrose angegriffenen Gelenke nicht belastbarer machen. Sie bekämpfen nur die Symptome. Zudem können Nebenwirkungen auftreten.
Zurückhaltung empfohlen ist auch bei entzündungshemmenden Schmerzmitteln (NSAR). Sie können bei einigen weichteilrheumatischen Beschwerden sinnvoll und nützlich sein, werden aber gerade bei Rückenschmerzen nicht mehr empfohlen.1 Nehmen Sie Rücksprache mit einer Gesundheitsfachperson, wenn Sie nicht-opioide Schmerzmittel häufiger einnehmen. Wenn Sie an einem Bewegungskurs teilnehmen, sollten Sie auch dessen Leiterin oder Leiter darüber informieren, dass Sie Schmerzmittel einnehmen, und sich nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten erkundigen.
Bei entzündlichem Rheuma konzentriert sich die medikamentöse Behandlung ganz auf die Entzündungshemmung. Sie werden reine Schmerzmittel nur verschrieben bekommen, wenn die entzündungshemmenden Medikamente Verstärkung brauchen. Dabei wird man im Sinne des WHO-Stufenschemas verfahren und Opioide nur in Ausnahmefällen länger einsetzen.
Das Wesentliche in Kürze
- Opioide sind starke Schmerzmittel mit schneller Wirkung und grossem Abhängigkeitsrisiko. Sie sollten nur ausnahmsweise länger eingenommen werden.
- Bei Arthrosen und anderen nicht-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen kann ein rezeptfreies Paracetamolpräparat (oder ein anderes nicht-opioides Schmerzmittel) körperliche Aktivitäten ermöglichen. Besprechen Sie auch diese situativ-präventive Schmerzmitteleinnahme mit einer Fachperson.
- Bei einer rheumatoiden Arthritis und anderen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen spielen reine Schmerzmittel nur eine Nebenrolle. Sie können eine zu wenig wirksame medikamentöse Entzündungshemmung ergänzen.
Publikation: 12. August 2025
Autor: Patrick Frei, Rheumaliga Schweiz
Fachliche Prüfung: Alexandra Litzenburger, Physiotherapeutin, M.Sc. Schmerzphysiotherapie
Anmerkung
- Corp N, Mansell G, Stynes S, Wynne-Jones G, Morsø L, Hill JC, van der Windt DA. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines. Eur J Pain. 2021 Feb;25(2):275-295. doi: 10.1002/ejp.1679. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33064878; PMCID: PMC7839780.
Stichworte
- Arthrose
- chronischer Schmerz
- NSAR
- Opioide
- opioidhaltig
- Paracetamol
- Rückenschmerzen
- Schmerz
- Schmerzmittel
- Schmerzmittelabhängigkeit
- Schmerzsignal
- Schmerztherapie